-----------------------------------------------------------
Letztes Jahr organisierten Lila und Sahira zusammen ein Picknick in einem Zürcher Park und luden auch Andrea ein. So erhielt Andrea den ersten tieferen Einblick in ihre schöne Freundschaft, von welcher Andrea bis heute sehr beeindruckt ist. Aus diesem Grunde kam ihr die Idee, ein Interview mit Lila und Sahira zu führen, in welchem ihre Freundschaft im Zentrum stehen würde. Migration und Flucht würde dabei unweigerlich ein Thema sein, sollte jedoch nicht im Vordergrund stehen.
ANDREA: Liebe Sahira und Lila, wie vorbesprochen, werde ich das Gespräch zu eurer Freundschaft mit ein paar Fragen anstossen und begleiten. Zu Beginn möchte ich jedoch den Lesenden dieses Interviews ein paar Eckdaten eurer Biografie mitgeben: Ihr seid beide fünfzig Jahre alt. Lila ist in Milano aufgewachsen und entschied sich nach mehrjährigen Reisen durch Europa und Australien in die Schweiz zu migrieren, während Sahira und ihre Familie sich gezwungen sahen, aus Pakistan in die Schweiz zu fliehen, da sie einer in Pakistan verfolgten Volksgruppe angehören. Lila macht Musik, spielt Gitarre, singt und leitet eine Spielgruppe für Kleinkinder; Sahira arbeitete während 20 Jahren in Pakistan als Schneiderin, hier in Zürich arbeitet sie im Stundenlohn für eine Putzfirma und ist Mutter von acht Kindern. Meine erste Frage: Seit wann kennt ihr euch? Wie haben sich eure Wege gekreuzt?
SAHIRA: Das war vor sieben Jahren, oder Lila?
LILA: Ja, im Frauencafé. Sevtap und ich hatten beschlossen, das Camp, welches damals gleich neben dem Frauencafé war, zu besuchen und die Frauen ins "Café" einzuladen, sie kennenzulernen, einfach zusammen zu sein. Sahira wohnte dort mit ihrer Familie, so habe ich sie kennengelernt.
SAHIRA (lacht): Ich wollte eigentlich nicht hin. Ich schämte mich, weil ich kein Deutsch sprach. Ich fühlte mich wie eine taube Person. Aber Lila und Sevtap gaben nicht auf. Sie kamen immer wieder und schliesslich sagte mein Mann: Warum gehst du nicht hin? Geh doch! Und so bin ich gegangen, aber nur ganz kurz geblieben. Mein Mann war völlig überrascht und wollte wissen, weshalb ich schon wieder zurück sei. Ich erklärte ihm, dass ich mich so schlecht fühle, weil ich mich nicht auf Deutsch ausdrücken kann. Mein Mann war schon seit einem Jahr in der Schweiz und hatte bereits ein bisschen Deutsch gelernt. Er sagt mir deshalb: Schau, frag Lila und Sevtap einfach immer: "Was ist das?" und "Was ist das?" So habe ich mit Lila und Sevtap Wörter wie Gabel, Tasse, Zwiebel, Kartoffeln und so weiter auf Deutsch gelernt. Später durfte ich auch in den Deutschkurs der AOZ und die Lehrerin war ganz überrascht, was ich alles schon wusste. Meine Vorkenntnisse halfen mir, schneller Deutsch zu lernen.
LILA (lacht): Wir mussten mehrmals hingehen. Schliesslich brauchte es Zeit, auch um gewisse Rituale aufzubauen, wie eine Atmosphäre des Vertrauens zusammen zu gestalten. So kam es, dass Sevtap und ich jedes Mal zuerst bei Sahira und ihrer Familie Tee trinken und bisschen essen mussten, und erst dann gingen wir zusammen ins Frauencafé, wo wir zusammen wieder Tee tranken, kochten, lachten, Deutsch übten, den Holzofen einfeuerten, nähten und so weiter. Sicherlich half es, dass das Café gleich neben dem Camp war. Doch Sahira lud dann immer öfter die Frauen aus dem Deutschkurs, den sie besuchte, ins Frauencafé ein, und sie kamen mit. Dank Sahira haben wir Doa, Nasbibi, Gülbegum, Grosse Bagi, Leinbach Bagi und viele Kinder, die auch mit ihren Müttern kamen, kennengelernt.
SAHIRA: Die Möglichkeit, in den Deutschkurs zu gehen, war für mich ein grosser Gewinn. Ich gehöre noch einer Generation Frauen an, die nicht lesen und schreiben gelernt hat. Meine jüngere Schwester oder meine älteste Tochter hingegen haben es schon gelernt. Indem ich das lateinische Alphabet gelernt habe, kann ich jetzt meiner Schwester und Tochter in Pakistan in Dari auf Whatsapp schreiben, jedoch nicht in unserer Schrift, sondern mit lateinischen Buchstaben. Meine Schwester und Tochter wiederum können auch das lateinische Alphabet, weil sie Englisch gelernt haben. Ich schreibe zum Beispiel: Chitori, das heisst: Wie geht es dir?
ANDREA: Als ihr euch getroffen habt, was für ein Bild, was für eine Idee hattest du, Lila, von Pakistan und du, Sahira, von Italien?
LILA: Ich wusste sehr wenig. Pakistan war für mich ein Land im Zusammenhang mit Indien. Ich wusste, dass muslimische Inder:innen nach Pakistan mussten, nachdem Indien unabhängig wurde. Jetzt, durch Sahira, weiss ich viel mehr über dieses riesige Land.
SAHIRA: Ich hatte überhaupt keine Idee von Italien. Das erste Mal fuhren mein Mann und ich zusammen mit Freunden vor zwei Jahren spontan nach Milano. Ich hatte nicht mit Lila gesprochen, so wussten wir eigentlich nur, dass wir den Dom besichtigen wollten. Und wir konnten uns auch nicht wirklich bewegen, weil wir kein Italienisch oder Englisch sprechen. Vor zwei Wochen sind mein Mann Yar, meine Tochter Rabia und ich zusammen mit Lila nach Milano gefahren. Das war ganz anders. Es war wunderschön. Wir haben bei Lilas Mutter gewohnt, sind auf die Märkte gegangen und haben Pizza gegessen. Es war grossartig! Filomena, Lilas Mutter, liess uns alle in ihrem Bett schlafen, während sie und Lila auf dem Sofa schliefen. Wir protestierten natürlich, aber Filomena blieb bestimmt und meinte: Das ist meine Wohnung und hier bestimme ich! Besonders genoss ich es auf dem Markt, auf dem es alles gab: Stoffe, Lebensmittel, Kleider, Küchengeräte, Schuhe etc. Ich fühlte mich wie in Pakistan. Ich möchte unbedingt wieder nach Italien fahren.
LILA: Ja, ich war auch sehr glücklich. Wir haben fast fünf Jahre über diese Reise gesprochen, und endlich waren wir zusammen in Italien.
ANDREA: Ihr seid nun sieben Jahre befreundet. Ihr habt so unterschiedliche Leben. Wie geht das zusammen?
LILA: Ich bewundere Sahira, wie sie in ihrem Leben steht. Sahira ist jederzeit hilfsbereit. Unermüdlich. Wir sprechen zusammen über den Alltag oder über das Leben, und ich bin immer wieder überrascht, wie sie die Dinge sieht oder Situationen erlebt und wie sie denkt und wie sie handelt. Dazu kommt der Respekt. Sahira weiss, dass ich keine Gluten essen kann und zudem kein Fleisch oder tierische Produkte essen will. Wir haben darüber immer wieder gesprochen, auch mit ihrer Familie. Wir essen sicher einmal in der Woche alle zusammen, Sahira kocht und isst Fleisch mit Reis, ich sitze daneben und esse Reis und Dahl. Dass wir solange zusammen befreundet sind, hat auch damit zu tun, dass wir gemeinsame Projekte haben, sei es zusammen ein Picknick im Park zu organisieren, oder ein Mobility-Auto zu mieten, um meinen Krimskrams zu zügeln oder wir zusammen versuchen, regelmässig ins Frauen*schwimmbad zu gehen oder gemeinsam an der Limmat entlang zu laufen. Oder mal auch zusammen einen Film anzuschauen und dabei einzuschlafen (beide lachen.)
SAHIRA: Lila ist wie eine Schwester für mich. Ich kann ihr vertrauen. Ich hoffe, das ist gegenseitig (lacht).
LILA: Ja, es ist gegenseitig. Sahira ist für mich auch Familie.
ANDREA: Liebe beide, gerne würde ich hier noch weiter in die Tiefe gehen. Aber das wäre schon eher ein Buchprojekt. Danke für eure Offenheit! Und übrigens: Wann findet das nächste Picknick statt? ;-)
-------------------------------------------------------------
Auf einer Solidarreise nach Apulien und Kalabrien Ende Oktober 2023 hat Bea Schwager Yvan Sagnet aus Kamerun kennengelernt. Die Gruppe hat sich vorgenommen, sich ein Bild vor Ort über die Situation der migrantischen Taglöhner zu machen. Es war Yvan Sagnet, der sie zum grössten Ghetto in der Region: Borgo Mezzanone – einem von ca. zwanzig –, das je nach Saison bis zu 7'000 Erntearbeiter beherbergt, führte. Yvan Sagnet hat das ausbeuterische System am eigenen Leib erlebt und initiierte und leitete den ersten Streik der migrantischen Taglöhner, die in der Feldarbeit um Foggia in Apulien beschäftigt waren. Nach vielen Jahren Arbeit bei Gewerkschaften in Italien gründete er die Organisation NoCap, deren Ziel es ist, die Landarbeiter aus den sklavenähnlichen Bedingungen zu befreien und ihnen angemessene Arbeits- und Lebensverhältnisse garantieren zu können. Bei seinem Besuch in der Schweiz Anfang dieses Jahres führte Bea Schwager dieses Gespräch.
BEA: Yvan, du hast als Student in Turin gelebt. Wie kam es, dass du während des Studiums als Taglöhner in Apulien auf den Feldern gearbeitet hast, und was hast du dabei erlebt?
YVAN: Ich bin nicht nach Italien gekommen, um gegen die Mafia zu kämpfen, ich bin gekommen, um zu studieren. Dann gab es Vorkommnisse, die mein Leben verändert haben. Während dem Studium ging mir das Geld aus und ich musste arbeiten. Und so habe ich Arbeit gesucht und eine in Süditalien bei der Tomatenernte gefunden. So bin ich vom Norden in den Süden gegangen. Was ich dabei gesehen habe, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe das Caporalato erlebt, das System der Mafia. Das sieht man nicht im Fernsehen, über dieses Ausbeutungssystem habe ich vorher nichts gewusst und das war ein grosser Schock für mich. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man unter diesen Bedingungen leben konnte: ohne Elektrizität, ohne Wasser in diesen Hütten aus Karton. Dies zu sehen war ein riesiger Schock. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Aber ich war extrem beeindruckt von den Migranten, die unter diesen Bedingungen gearbeitet haben. Das war wirklich alles schockierend. Dass so etwas in Europa existiert, das konnte ich nicht glauben.
BEA: Kannst du uns das System des Caporalato, das du erwähnt hast, beschreiben? Wie funktioniert dieses System und was bedeutet es für die Arbeitenden, die meist als Taglöhner arbeiten? Wer sind diese Arbeiter und unter welchen Bedingungen sind sie gezwungen zu leben? Gibt es für sie Probleme mit Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen?
YVAN: Das Caporalato ist ein System der Ausbeutung von Arbeitskräften. Es gibt den Caporale, der vermittelt zwischen den Landwirten und den Arbeitern. Ihre Rolle ist es, für den Arbeitgeber Arbeiter zu finden, die bereit sind, zu schlechten Bedingungen zu arbeiten. Zum Teil sind diese Caporali Leute, die früher als Arbeiter wie wir gearbeitet haben, aber dann "aufgestiegen" sind. Wenn die italienische Landwirtschaft Arbeitskräfte benötigt, um die Tomaten, die Orangen und das Gemüse zu ernten, dann rufen sie einen Caporale an und sagen ihm, ich benötige 500, 600 Arbeiter für den Monat August zur Tomatenernte. Der Caporale weiss, wo er die benötigten Arbeiter findet. Diese findet er in den sogenannten Ghettos, den Slums, wie ihr sie gesehen habt, das sind Migranten aus Asien und Afrika. Diese Caporali sind häufig aus denselben Herkunftsländern wie die Taglöhner, sie sprechen dieselbe Sprache, haben aber die Macht über sie.
Das Caporalato organisiert sich nach Herkunftsländern: Es gibt italienische Caporali und es gibt afrikanische Caporali. Ich war in einem Ghetto in Apulien mit ca. 1200 anderen Männern. Ich hatte zuvor meine Freunde gefragt, ob sie wüssten, wo es Arbeit gäbe, und sie hatten mir gesagt, dass Arbeiter in Apulien für die Tomatenernte gesucht würden, man brauche dazu einen Caporale, der wird dich suchen kommen im Ghetto. So habe ich gewartet. Ich habe den Caporale sofort erkannt, als er angekommen ist, weil er viele Leute um sich hatte und in grossen Lieferwagen angefahren kam. Er nahm unsere Dokumente und sagte, wir sollten warten, bis er einen Arbeitsvertrag erstellt habe, also haben wir gewartet. Manchmal muss man zwei bis drei Wochen warten, bis ein Caporale kommt und sagt, nun habe er Arbeit für uns. Während man am Warten ist, kann man nichts anderes unternehmen, weil man ja keine Dokumente hat, die in den Händen des Caporale sind. Wenn du die Aufenthaltsbewilligung nicht immer auf dir trägst, hast du das Risiko, von der Polizei verhaftet zu werden. Du bist also gezwungen, in diesem Ghetto zu leben und kannst dich nicht bewegen. Das Leben in diesen Ghettos ist schrecklich. Es gibt nur gerade fünf Toiletten für 1200 Menschen. Wer sich waschen möchte, muss zuvor vier Stunden in einer Schlange anstehen. Auch das Essen ist schwierig, weil es in den Ghettos sehr teuer ist. Die Unterkünfte sind Hütten aus Plastik und Karton und ich hatte noch nicht mal eine Hütte. Ich musste im Freien übernachten.
Was die Arbeitsbedingungen angeht … nach drei Wochen ist der Caporale wieder aufgetaucht. Er hat mir meine Dokumente zurückgegeben und er hat mir gesagt, dass ich nun zur Arbeit zugelassen würde. Ich solle am Folgetag um vier Uhr morgens bereit sein, dann würde er uns abholen. Alle Caporali kommen immer sehr früh am Morgen zwischen vier und halb fünf Uhr, um die Arbeiter mit Lieferwagen abzuholen. In einem Lieferwagen für 9 Personen, werden 25 Personen transportiert. Jeder muss 5 Euro Transportkosten bezahlen. Das sind Lieferwagen ohne Fenster, damit die Polizei nicht sieht, dass sie völlig überladen sind. Manchmal ist die Arbeitsstelle 100 km vom Ghetto entfernt, diese Fahrten sind sehr schwierig, weil man dicht zusammengepfercht ist.
In den Feldern angekommen verrichteten wir die Erntearbeit. Bezahlt wird man nicht pro Stunde, sondern pro voller Kiste Tomaten, die man gepflückt hat. Die volle Kiste ist 300 Kilo schwer. Pro Kiste erhält man 3.50 Euro. Das italienische Arbeitsgesetz sieht eine Bezahlung von 50 Euro für einen neunstündigen Arbeitstag vor. Aber das Caporalato-System sieht die Bezahlung nach Kisten vor. Wenn du also schnell arbeitest, verdienst du mehr, wenn du langsamer bist, weniger. Ich war nicht schnell, weil ich keine Erfahrung hatte mit dieser Arbeit und so schaffte ich es nicht, mehr als fünf Kisten zu füllen pro Tag. So verdiente ich zwischen 15 und 20 Euro pro Tag. Wir arbeiteten von 5 Uhr morgens bis sieben Uhr abends, also 14 Stunden pro Tag, um 15 bis 20 Euro zu verdienen. Von diesem Geld werden 5 Euro für den Transport abgezogen. Dann verpflichtet uns der Caporale seine Sandwiches zu essen, für die er pro Stück 3.50 Euro verlangt und für das Trinkwasser 1.50 Euro. So verdiente ich jeweils netto zwischen 4 und 5 Euro pro Tag. 4 Euro für 14–16 Stunden Arbeit! Das ist schrecklich, dieses System! Und der Caporale wollte nicht verstehen, wie wir uns fühlten. Er behandelte uns schlecht. Man wusste nie im Vorfeld, wann man arbeiten konnte und wie lange. Viele Leute erkrankten während der Arbeit, weil die Arbeitsbedingungen sehr, sehr schwierig sind. Und die Hitze! Im Sommer ist es in Italien sehr heiss. Auf den Feldern ist es sehr heiss und es gibt keinen Schatten. Wenn sich die Leute schlecht fühlen, lässt der Caporale sie einfach liegen und bringt sie nicht zum Arzt. Das sind unmenschliche Bedingungen!
BEA: Wie ist es mit all diesen Einschüchterungen und den Erniedrigungen dazu gekommen, dass ihr euch organisiert habt? Dass ihr gestreikt habt? War es schwierig, die anderen Arbeitenden zu überzeugen, beim Streik mitzumachen? Wie habt ihr das organisiert?
YVAN: Es war nicht einfach, den Streik zu organisieren. Nach fünf Tagen Arbeit habe ich mir gesagt: Ich verdiene nichts, ich hatte Gesundheitsprobleme, ich weinte die ganze Zeit. Ich nahm allen Mut zusammen und ging zum Caporale und sagte ihm, dass er uns nicht auf diese Art behandeln könne. Bis anhin hatte noch niemand den Mut aufgebracht, dem Caporale zu widersprechen. Also nahm ich meinen Mut zusammen und sagte dem Caporale: "Nein, so geht das nicht." Von diesem Moment an wusste ich, dass es so nicht weitergehen kann. So haben wir die Arbeiter zusammengerufen und gesagt, dass wir unter diesen Bedingungen nicht weiterarbeiten können. Wir haben den Caporale aufgefordert uns das Doppelte pro Kiste zu bezahlen, was er aber abgelehnt hat. Er hat uns dann ins Ghetto zurückgebracht. Dort haben wir begonnen, die Strasse zu blockieren und den Verkehr aufzuhalten. Dann ist die Polizei eingetroffen und der Bürgermeister und wir haben ihnen erklärt, was vor sich gegangen sei und dass wir nicht mehr bereit seien, so weiterzuarbeiten. Wir würden nun streiken. Und so kam es zum Streik von 1200 Erntearbeitern. Wir forderten die Abschaffung des Caporalato und mehr Rechte als Arbeiter. Unser Streik wurde dann durch Gewerkschaften unterstützt und in ganz Italien berichteten die Medien darüber. So bekamen wir auch viel Unterstützung durch andere Organisationen.
Die Organisation dieses Streikes war nicht einfach; einen Streik während Monaten durchzuhalten, das braucht viel Überzeugungsarbeit und Kraft. Viele Arbeiter haben mir gesagt: Wir arbeiten nicht, wir haben Hunger und nichts zu essen, was sollen wir tun? Wir konnten das so lange durchhalten, weil wir viel Unterstützung hatten, auch aus der Bevölkerung. Viele Leute brachten uns Essen. Es gab während dem Streik auch ein kulturelles Problem. Die Streikenden kamen aus vielen verschiedenen Ländern. Wir waren fast alle aus afrikanischen Ländern. Aber wir sprachen verschiedene Sprachen und neben den Sprachproblemen waren wir uns nicht immer einig. Die Einheit war aber sehr wichtig. So haben wir ein Komitee gebildet, in dem alle Herkunftsländer vertreten waren.
Und dann war noch das Problem der Bedrohungen von aussen. Es gab viele Bedrohungen. Das Caporolato System ist ein Teil der Mafia.
Durch unseren Streik haben die Arbeitgeber viel Geld verloren, von ihrer Seite her kamen viele Bedrohungen. Der Streik hat am Schluss einige konkrete Resultate und Verbesserungen gebracht.
BEA: Was sind das für Verbesserungen?
YVAN: Das Gesetz wurde geändert. Es wurde ein Gesetz gegen das Caporalato-System erlassen. Das heisst, jetzt ist es möglich, Klagen einzureichen gegen Caporali. Vorher war das unmöglich. Darüber sind wir sehr zufrieden. Und der symbolische Wert ist auch sehr wichtig. Es ist möglich aufzustehen, gegen dieses System der Sklaverei, und sich zu wehren. Dank dieses Streiks ist diese ganze Form der Sklaverei publik geworden, was früher unter dem Teppich gehalten worden ist. Die Bevölkerung hat gehört, was in Süditalien bei der Ernte geschieht, und ist nun sensibilisiert für dieses Thema.
BEA: Wie ist es dazu gekommen, dass ihr No Cap gegründet habt? Und was macht NoCap? Und was wünscht ihr euch für die Zukunft von NoCap?
YVAN: No Cap heisst einfach Nein zum Caporalato. Nein zur Illegalität und ja zur Gerechtigkeit.
Ich habe dieses bestehende System analysiert und bin zum Schluss gekommen, dass man ein neues System einführen muss, es bedarf eines neuen Instrumentes, um die Probleme der Arbeiter zu regeln. Das neue Gesetz über das Caporalato ist ungenügend. Der grosse Teil dieser Ausgebeuteten sind Migranten. Die Firmen haben diese Migranten gerne, weil sie ihre Rechte nicht kennen. Viele arbeiten für 2 Euro am Tag. Die Ausbeutung ist enorm. Das heisst, man muss auch Präventionsarbeit leisten. Wir alle sind Konsument:innen. Wir alle kaufen in den Supermärkten ein. Es sind die Supermärkte, die diese Arbeitsbedingungen verursachen, weil sie viel zu tiefe Preise an die Produzenten bezahlen. Es sind die tiefen Preise, die diese Arbeitsbedingungen hervorrufen.
Wir von NoCap wissen, dass wir nicht nur gegen die Produzent:innen kämpfen müssen, sondern auch gegen die Supermärkte mit ihrer Marktmacht.
Wir brauchen die Unterstützung der Konsument:innen. Alle von Ihnen sind Konsument:innen. Einen wichtigen Teil unserer Arbeit sehen wir darin, die Konsument:innen zu sensibilisieren. Bei jedem Kauf von Tomaten müssen wir uns überlegen, ob die Arbeiter, die sie gepflückt haben, dies unter angemessenen Bedingungen gemacht haben.
NoCap garantiert, dass die Arbeitsbedingungen der Erntearbeiter korrekt und angemessen sind. Dank NoCap konnten wir 1500 Arbeiter aus den Ghettos holen und ihnen korrekte Bedingungen mit Arbeitsverträgen und angemessenem Lohn garantieren. Und wir möchten, dass wir noch sehr viel mehr Arbeiter aus dem Caporalato-System rausholen können. Dafür müssen Sie uns alle helfen, indem Sie ethisch einkaufen.
BEA: Danke für das Gespräch, Yvan!
YVAN: Ich danke dir!
Hier können die NoCap Produkte in der Schweiz bezogen werden: neues-food-depot.ch
-------------------------------------------------------------
Filmtipp: Das neue Evangelium von Milo Rau. Yvan Sagnet wurde aufgrund seiner Rolle beim ersten Streik (2011) der migrantischen Taglöhner, die in der Feldarbeit um Foggia in Apulien beschäftigt waren, von Milo Rau angefragt, ob er die Jesusrolle im Film Das neue Evangelium spielen wolle.
-------------------------------------------------------------
Buchtipp: Getto Italia di Yvan Sagnet e Leonardo Palmisano
-------------------------------------------------------------
Seit 2015 arbeite ich als Aktivistin im transnationalen Netzwerk Watch the Med Alarmphone. Wir arbeiten in der Seenotrettung. Wir intervenieren nicht direkt auf dem Meer, sondern betreiben eine Telefonhotline. Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten, rufen uns an. Wir leiten ihren Notruf an die Küstenwachen weiter, überwachen die Rettungsoperationen, intervenieren bei unterlassener Hilfe, begleiten die Reisenden auf ihrer Überfahrt und unterstützen sie während der Zeit, in der sie auf einem meist überfüllten, miserablen Schlauchboot versuchen, den Wellen, dem Wetter und den eigenen Grenzen bezüglich Kraft, Zuversicht, Emotionen und Gesundheit zu trotzen. Eine Situation der extremen Verlassenheit und Ausgesetztheit. So stelle ich mir das vor. Nicht selten kommt jede Hilfe zu spät – oder gar nicht. In diesen Fällen müssen wir Abschied nehmen. Abschied von Menschen, die in den nächsten Minuten ertrinken werden. Es steht mir nicht zu, die Gefühle und Bewusstseinszustände von Reisenden in dieser Situation zu beschreiben. Ich kann nur die eigene Hilflosigkeit, die Wut, die Fassungslosigkeit benennen.
Meine Kindheit ist von den Erzählungen meiner Mutter geprägt. Von der jüdischen Verwandtschaft in Holland wurden – soweit bekannt – alle nach Auschwitz oder Sobibor deportiert. Niemand kam zurück. Ein Bildausschnitt hat sich mir eingeprägt. Ich weiss nicht, ob er aus einer konkreten Erzählung stammt oder ob er aus einer Mischung vieler Fragmente, zusätzlicher Lektüre oder gar Fotografien entstanden ist. Ich sehe vor meinem inneren Auge Menschen, die in einem Viehwaggon eingesperrt nach Osten transportiert werden. Durch die Ritzen der Waggonwände ist die Landschaft – die Aussenwelt zu sehen. Eine Aussenwelt, in der sich andere Personen befinden, deren Hilfe die Reisenden dringend bedürften. Ich erinnere mich an das Bild und die emotionalen oder auch praktischen Aspekte, die ihm zugrunde liegen. Der Verlust der Kontrolle über das eigene Leben. Die totale Verlassenheit und Ausgeliefertheit (Hannah Arendt). Das Wissen, dass es keine Personen gibt, die beistehen. Das Wissen, dass es hingegen eine Mehrheit gibt, die am Überleben der Reisenden kein Interesse hat, ihre Not nicht mitfühlen will, ja, im Gegenteil, den Tod und die Vernichtung als politische Notwendigkeit propagiert oder im Namen des eigenen Überlebens oder Vorteils in Kauf nimmt.
Noch weiter zurück in der eigenen Geschichte. Im 19. Jahrhundert migrierten andere Teile unserer Familie von Galizien – heutige Ukraine – in die Ostschweiz. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Die Erkenntnisse aus der Recherche über Migration vor ca. 150 Jahren, gerade auch was die Schweiz betrifft, haben mich sehr überrascht. Laut meinen Erkenntnissen scheinen die Bedingungen und der rechtliche wie auch gesellschaftliche Kontext von Flucht und Migration sich kaum verändert zu haben. Es gab bereits damals die Hotspots – wie zum Beispiel Auschwitz resp. Oswjecim –, die in ihrer Art genau so strukturiert waren wie die heutigen Brennpunkte Griechenland, Italien, Spanien, Libyen usw. … oder wie zum Beispiel Marseille während des Zweiten Weltkriegs. Die Umstände von Ankunft, Organisation der Weiterreise und Abfahrt ähneln sich in erschreckender Weise. Es gab die Menschenhändler, ohne die eine Flucht oder Migration sowohl damals wie auch heute rein praktisch gesehen nicht möglich ist. Es gab die Illegalität und die Kriminalisierung von Migration und unterstützenden Menschen oder Gruppen. Es gab die Stigmatisierung bei der Ankunft und gesellschaftliche Strukturen, die es kaum möglich machten, sich niederzulassen und ein produktives Leben aufzubauen. Es gab willkürliche Polizeigewalt. Es gab Rassismus, Antisemitismus, Fremdenhass und Vorurteile. Die Narrative wie auch die Formulierungen sind damals wie heute beinahe dieselben.
Ich habe den Eindruck bekommen, dass sich nicht viel verändert hat. Dass wir – um mit den Worten von Rahel Jaeggi zu sprechen (s. Bild rechts) – bis heute nur immer weiter vor uns hin stolpern und trotz der Katastrophen des 20. Jahrhunderts die Reflexionsprozesse kaum Wirkung zeigten.
Im Kontext unserer Arbeit an den europäischen Aussengrenzen werden wir oft gefragt, was denn aus unserer Sicht die Lösung wäre. Da wir auch ein politisches Netzwerk sind, argumentieren wir mit dem universalen Recht auf Bewegungsfreiheit, stehen für die Einhaltung der Menschenrechte ein und sehen unsere Arbeit auch in einem Umfeld verortet, in dem es um Dekolonialisierung und globale Gerechtigkeit geht. So gerechtfertigt diese Argumente sind – und aus meiner Sicht auch nicht wirklich verhandelbar, weil es sich um Entwicklungen handelt, die aus unterschiedlichsten Gründen sowieso stattfinden, gleichgültig, ob man sie blockiert oder nicht (Rahel Jaeggi) –, bleibt ein Gefühl des Unbehagens zurück. Der Gedanke in der zitierten Aussage von Rahel Jaeggi, der einen Fortschritt "weg von" favorisiert, lässt jedoch bestimmte Fragen zu, die zum Weiterdenken ermutigen – viel eher als die ultimative Forderung nach konkreten Lösungen.
"Weg von". Was braucht es, damit es undenkbar wird, das Entrechten und Sterbenlassen von Menschen an den Grenzen hinzunehmen? Was braucht es, damit wir Migration nicht mehr als Gefahr oder als einen kriminellen Tatbestand verstehen, sondern als universalen Wert? Was braucht es, damit wir Migrant:innen nicht mehr als passive Objekte sehen, die von Menschenhändlern hin und her geschoben werden, sondern als handelnde Subjekte, die ihre legitimen Gründe haben für das, was sie tun? Was braucht es, damit wir ein Bewusstsein für die Grenzen unseres Wissens bekommen, und fähig werden zuzuhören und anzuerkennen, dass eine konkret gelebte Erfahrung durch Lektüre, Social Media usw. nicht zu ersetzen ist? Die Aufzählung liesse sich fortsetzen.
Ein Freund sagte mal: Auch wenn wir nicht verstehen und nicht nachvollziehen können, warum eine Person in ein unbrauchbares Gummiboot steigt, um das Meer zu überqueren, hat diese Person ihre Gründe.
Und dafür sollten wir uns interessieren. Und zuhören. Und uns die Frage stellen, wie wir dahin kommen, dass illegale Migration für kommende Generationen ein unvorstellbarer Skandal sein wird (Rahel Jaeggi).
-------------------------------------------------------------
Es gibt nur ein einziges Foto von mir und meiner kaukasischen Grossmutter, Aikaterini, der Mutter meiner Mutter, und das ist das s/w-Foto nach meiner Taufe, vor der Kirche des Heiligen Dimitrios, in Thessaloniki, wo sie meine Hand hält. Ganz zart.
Ein typisches griechisches Tauffoto der 50er Jahre! Vor der neugebauten Kirche des Heiligen. Elf Frauen, zwei Männer, ich und drei andere Kinder.
Einst lebte diese Grossmutter, die so zart meine Hand auf dem Foto hält, auf dem Kaukasusgebirge, in einem der vielen Dörfer, in denen Griechen seit der Antike gelebt haben. 1923 wurde sie vertrieben und musste ihre Heimat über Nacht verlassen und fliehen.
Sie rannte um ihr Leben. Ein Teil ihrer Familie und die ihres Mannes gelangten ans Schwarze Meer und wurden mit englischen Schiffen nach Griechenland gerettet: in ein Land, dessen Sprache ihr fremd war. Die andere Hälfte der Familie floh in die Gebiete der neuen Sowjetunion. Diese Zwangsumsiedlung wurde vor hundert Jahren mit dem Vertrag von Lausanne 1923 entschieden.
Aikaterini, meine Grossmutter, 27 Jahre alt, verheiratet mit Dämian, einem Feldpolizisten, lebte als praktizierende Heilerin und Hebamme in dieser Bergregion des Kaukasus. Sie sprach Pontisch – einen altgriechischen Dialekt – Türkisch, Russisch und verstand kein Wort Neugriechisch. Trotz alledem, war sie eine ganze, stolze und selbstbewusste pontische Griechin.
Meine Taufpatin, Eftichia, kam aus Smyrna, aus Kleinasien. Sie floh, als die Stadt in Brand gesetzt wurde und die Griechen vertrieben wurden. Auch sie rannte um ihr Leben wie Tausende andere Griechen, die ans Ufer getrieben wurden. Auch ihr gelang es, auf einem englischen Schiff nach Griechenland zu kommen. Trotz des grossen Altersunterschieds, war sie eine sehr gute Freundin meiner Mutter. Auf dem Foto hält sie mich auf dem Arm, während meine kaukasische Grossmutter Aikaterini neben ihr steht und mit ihrer zarten Handbewegung ihre Zuneigung zu mir zeigt. Zwei Witwen in Schwarz, Patentante und Großmutter, halten mich als erstes Mädchen-Enkelkind meiner Familien in ihrer Mitte. Und ich, gekleidet in Weiss, entstanden aus einer Ehe, die gegen den Willen der väterlichen Familie geschlossen wurde, wirke zufrieden.
(Weit bis in die 60er Jahre hinein heirateten Griechen nicht in eine andere Sippe hinein.)
Vielleicht ist das der Grund, weswegen meine Grossmutter Maria, väterlicherseits, nicht bei meiner Taufe zugegen war und nicht auf dem s/w-Tauffoto zu sehen ist. Und vielleicht aus diesem Grund wollte Vater mir ihren Namen geben, um unsere Familie mit ihr zu versöhnen.
Auch diese thrakische Grossmutter musste ihre thrakische Heimat 1923 über Nacht verlassen und nach Griechenland fliehen. Sie sprach immer davon: weisst du, in der "Heimat" – und sie meinte immer Canakkale, wo sie herkam, ihre Geburtsstadt bei den Dardanellen – da hatten wir ein wunderschönes Haus. Mein Vater war Priester ...
Hinter mir auf dem Foto steht Vater – Mutter durfte an der Taufzeremonie nicht dabei sein, das war so Brauch. Nachbarskinder, die während der Taufe auf den Ausruf des Kindnamens warteten, rannten sofort los, um der Mutter zuhause den Namen ihres Kindes zu verraten. Dafür gab es ein paar Münzen für Süssigkeiten. Das waren noch Zeiten, wo Patinnen echte Namensgeberinnen waren. Laut der orthodoxen Kirche galt als Name, was von der Patin in diesem Moment gesagt wurde.
Meine Mutter sah nicht ein, warum ihr Mann das Vorrecht auf die Namensgebung ihres Kindes haben sollte, wo ich doch auch ihr Kind war. Mit meiner Patentante heckte sie einen Plan aus.
Und so rief meine Patentante auf die Frage des Popen, "wie soll das Kind heißen?": Eftichia soll das Kind heißen. Eftichia, die Glückliche, so wie sie.
Mir wurde immer wieder erzählt: "Zu deiner Geburt kam deine kaukasische Grossmutter nach Thessaloniki angereist. Es war eine Tagesreise in der damaligen Zeit, ihr Dorf in Nordmazedonien zu verlassen und in die Klinik nach Thessaloniki zu kommen. Obwohl sie nur Pontisch sprach, fand sie den Weg zur Entbindungsstation und fand ihre Tochter weinend vor. Sie weint und weint und weigert sich, ihr Kind in den Arm zu nehmen, sagte eine Schwester zur Grossmutter. Du warst kein Junge. Und dein Vater zog mich während der Schwangerschaft auf mit dem Spruch, wenn du mir keinen Jungen machst, dann lasse ich mich von dir scheiden. Aber, das war nicht der ganze Grund, warum ich so weinte. Du warst ein sehr, sehr schwarzes Baby. Untergewichtig, hässlich und hattest Gelbsucht. Als hätten wir dich bei Zigeunern geholt. Deine Grossmutter hob das Bündel – dich – auf, damals schnürte man die Kinder zu einem Bündel zusammen, und hielt dich vor mein Gesicht. Ich weigerte mich, dich in den Arm zu nehmen. Da gab sie mir eine saftige Ohrfeige, so dass mir das Weinen verging, und sagte, wenn du jetzt nicht auf der Stelle dein Kind in den Arm nimmst, dann nehme ich es mit und gehe. Und du, du wirst uns nie wieder sehen."
Und meine Mutter und mein Vater lachten immer, wenn sie mir diese Geschichte erzählten. Kein Mensch konnte ahnen, wie schön du werden wirst, mein wildes Zicklein, sagte er und streichelte mir, auch als Erwachsene, als ich selber schon ein Kind hatte, immer zart über die Haare.
Aikaterini, meine kaukasische Grossmutter, machte Feuer, heisses Wasser, badete mich, massierte mich, sie wusste was Babys brauchten. Zurück in dem kleinen Haus ohne Strom und fliessendes Wasser, im Armenischen Flüchtlingsviertel von Thessaloniki, oberhalb und ausserhalb der Burgmauern, in dem wir wohnten, das sie von einem Armenier, der auch aus der Osttürkei geflohen war und nach Amerika weiter emigrieren wollte, gekauft und meiner Mutter als Mitgift geschenkt hatte, blieb sie sehr lange – sagte man mir später – und beschützte, behütete und verwöhnte mich.
Ich habe sie mindestens sechs Jahre meines Lebens gekannt. Aber, die stärkste Erinnerung in mir ist die ihrer Beerdigung. Ich gebe zu, dass ich nicht ganz begriffen hatte, was eine Beerdigung ist. Dass Onkel Leo ohnmächtig wurde, kam mir merkwürdig vor. So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen: dass ein Mann auf die Knie fiel und einfach wie eingeschlafen aussah, während alle anderen weinten und hinter einer Holzkiste langsam hergingen. Auch hatte ich noch nie zuvor gesehen, dass Männer weinten. Es war das erste Mal. Ich dachte, vielleicht tun sie nur so als ob. Ich hatte nicht begriffen, dass meine Ya-ya (Grossmutter) weggegangen war.
Von ihr habe ich einen Mörser aus Bronze und eine Schere, die sie bei der Flucht aus dem Kaukasus retten konnte. Ich glaube, mich zu erinnern, an ihre zarte Haut.
-------------------------------------------------------------
Als meine Mutter in einem Asylzentrum in der Innerschweiz arbeitete, war da dieser Koch. Ich war etwa neun Jahre alt und ging nach der Schule manchmal ins Zentrum und wartete, bis meine Mutter Feierabend hatte. Der Koch, er reichte mir jeweils einen Teller mit Essen. Essen, das für mich nach Heimat schmeckte. Der Koch mit den Narben am Rücken. Ich bin traurig, seinen Namen erinnere ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich an die Trauer um ihn. Er wurde zurückgeschickt. In die Türkei. Ich erinnere mich auch nicht mehr an den Moment, als meine Mutter mir erzählte, dass er nicht mehr lebe. Dass er umgebracht worden sei. Doch ich erinnere mich: ich erinnere mich an einen Mann, dessen Name ich nicht mehr weiss und der mir einen Teller Essen reichte und dessen Geschmack ich nie mehr vergessen werde. Ein bisschen Kreuzkümmel, aber nicht zu viel.
In meiner Erinnerung stehe ich zwischen zwei Bäumen, die Handflächen an der Rinde. Ich blicke hoch in ein Gesicht, das verblasst vor dem Licht dahinter. Es scheint mir, als würde ich geblendet, als hätte ich halbblind in dieses Licht geblinzelt. Es ergibt keinen Sinn. Deutlich ist in meiner Erinnerung einzig ihre wohlmeinende Bemerkung, die mich hinwegwirbelt als wäre ich eine Daunenfeder – winzig und klein und leicht, immer in der Schwebe. Das überblendete Gesicht lächelt zu mir hinunter: «Du chasch dänn guet Dütsch.» Ich sehe die Rinde der Bäume ist braun und dick und rissig. Ich reisse daran. Ich weiss nicht mehr, was ich geantwortet habe; ob ich geantwortet habe. Ich glaube, ich kleinmädchenlächelte und schwieg hinauf zu diesem konturlosen Gesicht. Ich weiss noch, wie sich ein Riss auftat. Ein Riss zwischen dem Dasein und dem Vondortkommen. Ein Riss zwischen Selbstverständlichkeit und Infragegestelltwerden. Ein Riss, in dem ich begriff, dass nicht sie falsch lag, sondern ich. Ein Riss, in dem ein Warum sich breitmachte. Ein Riss und ein Warum mitten durch mich hindurch. Das Warum tat weh. In diesem Augenblick wusste ich aber auch um etwas, das ich hatte. Nicht in Einzelheiten, aber ich wusste, selbst wenn etwas an mir in Frage gestellt wird, so kann ich mein Recht auf mein Hier-Sein behaupten, auch wenn es ein Zugestehen des Vondort-Kommens bedeutete. Schliesslich hatte ich diesen roten Pass und zwar seit Geburt. Und meine Eltern ebenfalls seit Geburt. Und sogar der Vater der Mutter und die Mutter des Vaters hatten diesen roten Pass, von Geburt an. Eine rote Ankerkette, die dich im Hafen der Sicherheit vertäut.
Vielleicht im gleichen Jahr, vielleicht früher, vielleicht später, träumte ich diesen Traum: Acht oder neun Jahre alt fuhr ich mit meiner Mutter und einer ihrer Freundinnen in einem kleinen Lastwagen, wohin? Ich weiss es nicht. Zwischen Führerkabine und der Ladefläche war ein dicker Vorhang, dahinter wusste ich, waren Menschen, viele Kinder. Und wir waren auf der Flucht. Wovor, darüber liess mich mein Traum im Unklaren. Irgendwann wird klar, meine Mutter und ich müssen nach hinten zu den anderen auf die Ladefläche. Ich frage: «warum?» Unsere Haut ist zu dunkel, unsere Augen zu braun. Wir könnten Verdacht erregen, angehalten werden und damit die anderen gefährden. Vielleicht ging der Traum weiter. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an das «zu dunkel».
Meine kindliche Selbstbezogenheit bereitete mir Albträume. «You had enough sun», sagte meine Grossmutter. «You're getting too dark, she said.» But my skin was just as brown as hers. «Listen Loulou – the old days in Persia …», so jeweils beginnen die Erzählungen meiner Grossmutter. Weit über 90 ist sie heute, sie, die auf vier Kontinenten gelebt hat, mehr als einmal geflüchtet ist, mehr als einmal migriert ist – aus «privaten» Gründen oder aus solchen, die sich leichter mit einer westlichen Weltgeschichte verknüpfen lassen.
«The old days in Persia …» Ein Land, zu dem ich keine Beziehung habe, ausser ein bisschen Sehnsucht nach etwas, das vielleicht nie existierte. «So schön sei es, dieses Land», «so interessant» sagen die Leute, «ob ich denn nicht mal …?» Nein. Ich wollte nicht und jetzt kann ich nicht. Und diese Sprache! Meine Grossmutter hat mit ihren Kindern nie Farsi gesprochen. Sie sprach Englisch mit ihnen, eine Sprache, die sie erst als junge Frau in London gelernt hatte, nach ihrer ersten «privaten» Flucht aus Iran. Eine ehemalige Arbeitskollegin erzählt mir, wie bereichernd und wichtig es für sie gewesen sei, Mandarin zu lernen. Die Sprache der Eltern. Was gälte nun für mich? Farsi? Rumantsch? Cambridge English? Tschechisch gar? Eine andere Kollegin sagt: «Englisch, die Sprache der Kolonialherren.» «The old days in Persia …» Dies also soll nun die Sprache der Kolonialherren sein? Und der Erzählauftakt selbst? 1001 Nacht? «Selbstorientalisierung»? Dieser Moment zwischen meiner Grossmutter und mir, wenn sie die immer gleichen Geschichten erzählt, auf die ich noch immer aufgeregt warte, weil ich dann weiss, dass alles gut ist. Dieser Moment. Ich weigere mich, als Enkeltochter diesen Moment zwischen ihr und mir erdrücken zu lassen von gewaltvoller imperialer und kolonialer Weltgeschichte. Auch als Historikerin weigere ich mich, darin nur jene Geschichte zu lesen.
Es gibt keine Muttersprache in dieser Familie, es gibt keine gemeinsame Sprache und doch gibt es eine Sprache. Dieses Familienenglisch gemischt mit Schweizerdeutsch, unsere Gesten, unsere Mimik. Wären die Missverständnisse und Konflikte kleiner, gäbe es eine Muttersprache? So jedenfalls haben wir eine gute Ausrede. Die Schweiz ist nicht Käse und Schokolade und das Matterhorn. Die Schweiz ist auch nicht Finanzplatz, Profiteur und hat das Rote Kreuz erfunden. Die Schweiz ist … Die Schweiz ist, einen Bürgerort haben. Das Schweizerischste, was es überhaupt gibt. Bürgerort, jener Ort, an dem eine ihre Heimatberechtigung hat. Jener Ort, der dir in der Schweiz deinen Geburtsschein ausstellt. Ich bin berechtigt, in Samedan Heimat zu haben. Die Gemeinde Samedan hat bestätigt, dass ich am soundsovielten in Zürich geboren bin. Sehr selten bin ich da, an diesem meinem Heimatort. Während eines dieser Besuche steige ich auf den Muottas Muragl, 2453 m über Meer, ich sitze auf einer Bank und lese Desorientale von Négar Djavadi. Ich lese die mir vertraute, so vertraute nachgeschobene Silbe «Dschan» oder «Joon». Pete-Joon, so hat meine Grossmutter meinen Grossvater immer genannt, Pete-Liebling. Pete-Joon und Parivash hatten sich in London kennengelernt, auf einem Bahai-Meeting. Und ich schaue herunter nach Samedan, dort, wo ich an der Hand meiner anderen Grossmutter Anna mit den kurzen Beinchen einer Vierjährigen durchs Dorf getrottet bin – ein Dorf, das nach der Trennung meiner Eltern nur noch eine Erinnerung sein wird für mich. Ich denke daran, dass meine Mutter und eine ihrer Schwestern an den beiden Enden einer der wichtigsten Ölpipelines in Iran geboren worden sind. In Masǧed-e Soleymān und Abadan. Am einen Ende soll 1908 das erste Mal Erdöl aus dem Mittleren und Nahen Osten gefördert worden sein. Am anderen Ende, in Abadan, wurde 1918 eine Ölraffinerie in Betrieb genommen. Diese sei wohl, so die Encyclopædia Britannica, Ende der 1970er-Jahre die grösste Ölraffinerie der Welt gewesen. Ich denke daran, wie eine schwarze Kugel den Vater meines Vaters nie wirklich losgelassen hat. Wäre die Mehrheit der Kugeln schwarz gewesen, wäre mein Bürgerort heute wohl nicht Samedan. Tscheche sei er – nicht Slowake, habe mein Urgrossvater jeweils betont. Mhm. Jener Urgrossvater, der als junger Mann in die Schweiz migrierte und wegen meiner Urgrossmutter auch hierblieb. Beide wurden sie staatenlos durch die Zerschlagung der Tschecho-Slowakischen Republik. Erst 1950 erhielten sie wieder Papiere – Schweizer Papiere. Die Einbürgerung – so habe mein Grossvater erzählt – sei durch eine Gemeindeabstimmung erfolgt. Weisse und schwarze Kugeln. Weiss für JA, schwarz für NEIN. Bei der Einbürgerung meines Grossvaters väterlicherseits: eine einzige schwarze Kugel. Vergessen konnte er sie offenbar nie. Und ich denke an den Vater meiner Mutter, ein Schweizer mit kolonialer Geschichte, geboren in Bombay, heute Mumbay. Mein Grossvater, dessen Vorfahr von 1874 bis 1879 Ständerat war – für eben jenen Kanton, wo per Zufall auch der Vater meines Vaters als Schweizer anerkannt wurde. Und als ich einige Tage später dies alles aufschreibe, erinnere ich mich daran, wie mein bester Freund im Gymnasium lange Zeit dachte, Samedan liege in Iran. Ich habe sehr gelacht, als das rauskam. Aber Thomy, vielleicht hattest du recht. Als ich einige Stunden später in Samedan stehe, mitten im Dorf, rufe ich meinen Vater an: "Ich bin hier." Und am anderen Ende höre ich die bündnerische Einfärbung in seinem Dialekt plötzlich wieder stärker. "Wo bist du", fragt er mich. Ich sehe mich kurz um und stelle überrascht fest: "Ich stehe vor dem Coiffeur Lada." Coiffeur Lada since 1928 steht da. Wir lachen beide. Es war das Geschäft seiner Grosseltern, meiner Urgrosseltern. Emilia & Ladislav. Samedan – Iran – Altdorf – Zürich. Berge, Dörfer, Grossstädte und Möchtegerngrossstädte, Mythen und Zuschreibungen und Geschichtsklitterung, und immer wieder diese eine Frage: Woher kommst du? Nein, woher kommst du wirklich? Woher kommst du ursprünglich? Woher kommt die Farbe deiner Augen und deiner Haare, woher kommt deine Hautfarbe, woher kommen diese Gesichtszüge, woher kommt dieses Feuer, diese Power aus dem Süden, diese Rasse in den Augen? Mein Vater meint zu mir: Sag doch einfach, dass du aus dem Engadin bist. Die sehen doch auch oft so aus, diese braunen Augen und Haare und die Haut. Ich bin doch aus dem Engadin, denke ich mir. Und ich erinnere mich an einen Sommer in Spanien. Mein Vater und ich sind auf dem Wochenmarkt. Wir sind bei meinen Grosseltern in den Ferien. Die Eltern meiner Mutter, die damals erst kürzlich aus der Schweiz nach Spanien migrierten. Einmal mehr. Vor uns eine deutsche Familie: "Helmut, Achtung dein Geldbeutel", sagt die Frau und schaut zu uns nach hinten. Mein Vater und ich lächeln – diese doofen Deutschen, wenn die wüssten, dass wir alles sehr genau verstanden haben. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Mein Vater spricht immer von denjenigen, denen es wirklich schlecht gehe. Menschen, die aus ökonomischen Gründen fliehen, die fliehen wegen Kriegen und Verfolgung. Mein Vater kennt seine Privilegien sehr genau. "Helmut, Achtung dein Geldbeutel" hinterlässt dennoch in meinem damals elfjährigen Nochkindkörper einen weiteren kleinen Giftpfeil. Eine surreale Form von Hilfslosigkeit. Eine spezielle Art von Verwirrung. Ich denke an den Autor Sascha Stanišić und seinen Vorschlag, «heimaten» als Verb einzuführen – «heimaten», etwas das wir gemeinsam tun können, nicht ein fixer Ort, sondern eine Tätigkeit. Ich denke an die feministische Theoretikerin Christina Thürmer-Rohr, die den Heimatbegriff loswerden wollte und sich wünschte, wir würden uns alle als Heimatlose betrachten, als Vagabundinnen. Und ich denke an den Sammelband «Eure Heimat ist unser Albtraum», herausgegeben von den Autor_innen und Publizist_innen Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah. Das Unbehagen mit dem Heimatbegriff – ich teile es. Doch hier, hoch oben über der Oberengadiner Seenplatte unter dem Spiel der Wolken und der Sonne, hier oben denke ich: Ich bin keine Vagabundin.
In der Nähe der Bahamas, in der Sargassosee, erblicken die Aale das Licht der Welt. Alle sind von dort. Frag einen Aal, woher er kommt und sie werden dir alle die gleiche Antwort geben können.
Für meine Mutter Mona, 22.4.1956, * Masǧed-e Soleymān, Iran, †16.4.2023, Ciudad Quesada, Spanien und für meine Grossmutter Parivash, 7.4.1929, * Teheran, Iran, † 15.8.2023, Ciudad Quesada, Spanien.
-------------------------------------------------------------
Als ich gebeten wurde, für den neuen Themenschwerpunkt bei mille et deux feuilles meine Mutter über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Einwanderung zu interviewen, ergriff ich die Gelegenheit beim Schopf. Das Interview war für mich eine Möglichkeit, direkt von Filomena die Worte zu hören, die ihre Geschichte erzählen.
LILA: Hallo Mama, wir sind hier zu einem Interview zusammengekommen, um etwas über deine Erfahrungen als Kind zu lernen, das in Bitonto, Apulien, "im Süden", geboren und aufgewachsen ist. Im Jahr 1960, mitten in deiner Adoleszenz, zogst du mit deiner Familie nach Turin im Piemont, "in den Norden", und dann, als Frau im Alter von 20 Jahren, nach Mailand. Heute bist du 78 Jahre alt, und ich habe endlich die Gelegenheit, dich zu fragen: Wie hat alles angefangen, wer hat die Entscheidung getroffen, wegzugehen, und warum?
FILOMENA: Alles begann mit einem Sturz meines älteren Bruders Giacomo bei der Arbeit. Er arbeitete im Dorf als Maurer und nach diesem Sturz auf der Baustelle begann er, epileptische Anfälle zu bekommen. Meine Eltern wollten ihren Kindern eine Zukunft geben, insbesondere dem Ältesten, der wegen seiner Epilepsie keine Arbeit mehr finden konnte. Es gab natürlich auch die grosse Hoffnung, dass "im Norden" gute Ärzte und gute Krankenhäuser ein Heilmittel für ihn finden würden. Also, um dir zu antworten, meine Eltern haben die Entscheidung getroffen. Aber zunächst einmal ist mein jüngerer Bruder Vincenzo 1958 nach Turin gegangen: Er war bereits Bäcker und fand leicht eine Stelle in einer Bäckerei. Er wohnte bei einer Familie von Bekannten aus demselben Dorf, die vor langer Zeit ausgewandert waren und die meinen Vater sehr liebten, weil er ihnen so viel geholfen hatte, als sie noch im Dorf lebten. Und so war Vincenzo zu Gast bei dieser Familie, die uns zwei Jahre später half, eine eigene Wohnung zu finden, ebenfalls in Turin.
LILA: Und nach Vincenzo?
FILOMENA: Manuele, mein anderer Bruder, ging dann weg, und auch er fand sofort Arbeit. Meine Geschwister sagten oft, dass sie ihre Familie vermissten, und so beschlossen mein Vater und meine Mutter, ihre Arbeit als Hausmeister in einem Internat für Seminaristen im Dorf so schnell wie möglich aufzugeben, um wieder mit ihren Kindern zusammen zu sein.
LILA: Und du?
FILOMENA: Und ich zuletzt. Sobald ein Haus in Turin gefunden war, fuhr meine Mutter mit meinem Bruder Giacomo und einem Umzugswagen mit all unseren Möbeln los. Dann, als Letzte, sind auch mein Vater und ich mit dem Zug abgereist. Es war der 1. Mai 1960. Als wir in Turin ankamen, sah ich sofort viele Menschen auf dem Hauptplatz versammelt, und ich fragte meinen Vater, was da los sei. So habe ich gelernt, was der 1. Mai bedeutet.
LILA: Wie war es für dich, als du die Nachricht erhieltst, dass du und deine Familie dein Dorf verlassen würdet, um in den Norden zu ziehen?
FILOMENA: Es war schön. In dem Sinne, dass ich wusste, dass wir eine bessere Zukunft finden würden, auch für mich. Zwei Wochen nach meiner Abreise bin ich fünfzehn Jahre alt geworden, und ich hatte schon eine Arbeit gefunden. Ich war ein Jahr lang Arbeiterin in einer Schraubenfabrik und arbeitete danach in einer Fabrik, die die Nudelmaschinen herstellte.
LILA: Wie war es für dich, mit fünfzehn Jahren in einer grossen Stadt zu arbeiten, weit weg von dem Dorf, an dem du geboren und aufgewachsen bist?
FILOMENA: Schön. Alles war neu, und ich konnte finanziell dazu beitragen, die Miete und andere Ausgaben zu bezahlen, die die Familie brauchte. Es war ein neues Leben, das wir gemeinsam bewältigten. Ich war flink, ich lernte schnell und in der Fabrik schätzte der Chef mich dafür, er liess mich immer die neuen Maschinen ausprobieren. Einmal, ich erinnere mich, verletzte ich mich bei der Arbeit sehr und sie brachten mich ins Krankenhaus. Dort fing ich an, in meinem Dialekt zu schreien, und der Arzt machte sich über mich lustig, aber nur, um mich abzulenken, damit ich mich nicht auf die Schmerzen konzentrierte. Sie haben die Wunde mit so vielen Stichen genäht, dass man sie heute noch sehen kann.
LILA: Du bist in den Nachkriegsjahren in Apulien aufgewachsen. Du hattest deinen Akzent, deinen Dialekt, die typischen Bräuche der Region. Gab es Zeiten in Turin, in denen du das Gefühl hattest, irgendwie anders zu sein oder diskriminiert zu werden?
FILOMENA: In den ersten Momenten, ja, ein bisschen. Aber nicht bei der Arbeit. Es gab viele Emigranten, aus dem Süden und aus dem Norden. Eher in der Nachbarschaft, im Wohnblock. Aber nur am Anfang. Dann haben die Leute gesehen, wie wir sind, und uns willkommen geheissen. Sogar die Leute aus dem Piemont. Oft hörte man auf der Strasse Worte wie "terun" oder man sagte, dass wir aus "bassitalia" ... kamen. Aber wir brachten unsere Arbeitskraft in den Norden. Damals arbeiteten viele Süditaliener:innen in Turin, und die Stadt wurde auch dank uns reich, dank derer, die bei Fiat und in den Fabriken arbeiteten. Es war der Boom der Fabriken. Alle haben immer gearbeitet, auch der Bruder, der an Epilepsie litt. Vielleicht haben mein Bruder Manuele und mein Bruder Giacomo mehr gelitten als der Rest von uns. Sie waren älter als ich und hatten bereits ihre eigenen Freunde im Süden. Ausserdem ist es nicht leicht, sich an eine neue Mentalität zu gewöhnen. Aber sie heirateten dann Frauen, die aus unserem Dorf in den Norden ausgewandert waren und in Turin ein Leben führten. Manuele war der Einzige, der während der Fabrikkrise Mitte der 1980er Jahre ins Dorf zurückkehrte.
LILA: Du warst ein sehr junges Mädchen, ein Teenager. Was hat es für dich bedeutet, dein Leben in Turin fortzusetzen?
FILOMENA: Es gab mir das Gefühl, eine Zukunft aufzubauen. Ich bin ein positiver Mensch, der sich leicht an die Umstände anpasst, so sehr, dass ich vier Jahre später wieder auswandern musste. Und ich kam in Mailand an! Und wieder, um mich an eine neue Lebensweise anzupassen und ... an die Ehe. Diesmal ohne meine Familie. Und das war das Schwierigste. Ich musste heiraten, ich war schwanger, ich erwartete ein Baby und so weiter. Ich musste sogar meine Tochter früh meiner Mutter anvertrauen, damit ich wieder arbeiten konnte. Ich wollte um jeden Preis meiner neuen Familie helfen, und ein Gehalt war nicht genug. Zuerst ging ich in eine Stahlbürstenfabrik, und dann hörte ich von einem Kollegen, dass bei Osram, dem Glühbirnenhersteller, Personal gesucht wurde. Ich meldete mich krank, hatte das Vorstellungsgespräch, und ich wurde eingestellt. Wir arbeiteten in Schichten von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags und von 14 Uhr bis 22 Uhr. Das Gehalt war sehr gut, wir hatten bezahlten Urlaub und auch den 13. Monatslohn. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zum Direktor und er hat mir immer geholfen, wenn ich ihn brauchte. Sogar als mir in der Metro in Mailand mein Portemonnaie mit dem Geld für den Urlaub meiner Tochter gestohlen wurde. Als ich dem Direktor davon erzählte, gab er mir sofort einen Kredit auf mein Ehrenwort hin. Auch als ich nicht mehr in der Fabrik arbeitete, habe ich immer viel zu Hause gearbeitet. Ich habe mich um den Sohn meiner Schwägerin gekümmert, dann um meinen Schwiegervater, meine Mutter und sogar meinen Neffen, damit die anderen arbeiten gehen konnten.
LILA: Hattest du im Laufe deines Lebens jemals den Wunsch, wieder in Apulien zu leben?
FILOMENA: Nein. Nein. Nein. Niemals. Als mein Bruder 1984 zurückging, um wieder in Apulien zu leben, hatte er eine tiefe Krise, die er später überwunden hat, aber es war schwierig für ihn, sich wieder an die Gepflogenheiten und das Leben im Süden zu gewöhnen. Vor allem bei der Arbeit.
LILA: Und würdest du heute zurückgehen?
FILOMENA: Nein. Es geht mir gut mit meiner Familie hier in Mailand. Ich habe mich gut integriert. Auch wenn wir wissen und spüren, dass wir aus dem Süden kommen. Zu Hause haben wir immer unseren Dialekt gesprochen. Auch die Esskultur, die ich von meiner Mutter gelernt habe, ist immer gleichgeblieben. Aber ich mag es hier. Ausserdem fühle ich mich wohl und ich habe mich immer gut mit allen verstanden. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten und liebe auch das Reisen. Wir sind immer mit dem Wohnmobil verreist, und wir haben neue Kulturen kennengelernt, und das war toll für mich. Sogar mein Mann hat nie wieder in Süditalien leben wollen, obwohl er viel mehr gelitten hat als ich als Emigrantin. Ich hatte schon die Erfahrung, eine Auswanderin zu sein, gemacht. Er hingegen war schon neunzehn und wollte das Land seiner Geburt und seine Freunde nicht verlassen. Aber er hatte viele Geschwister; das jüngste war sechs, als die Familie nach Mailand auswanderte. Sie waren auf der Suche nach einer Zukunft, nach Arbeit. Für all diese Kinder.
LILA: In deiner Biografie hast du diese Erfahrung der Immigration gemacht. Was denkst du über die Menschen, die heute in den Norden, nach Italien, nach Europa auswandern?
FILOMENA: Sie tun mir sehr leid, weil sie das Meer überqueren müssen und das sehr gefährlich ist. Heute ist die Reise eine Frage von Leben und Tod. Für uns war es nicht so. Ich persönlich kenne viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die hier leben, aus Albanien, aus Tunesien, der Türkei, Pakistan. Wir müssen uns gegenseitig helfen. So wie wir damals, sind die Menschen heute auf der Suche nach einer besseren Zukunft oder einem Job, um es besser zu haben. Manchmal sucht man auch nach einem Leben fernab von Armut oder Kriegen. Oder vielleicht kommt jemand wie wir nach Italien, um einem Familienmitglied zu helfen, eine bessere Behandlung zu bekommen, sich von einer Krankheit zu kurieren. So wie wir es taten, als wir von Bitonto aus "in den Norden" zogen, mit so vielen Hoffnungen.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Sahira und Lila in Zürich, 2017 © Privat

Ghetto in Kalabrien, 2024 © Ursula Markus
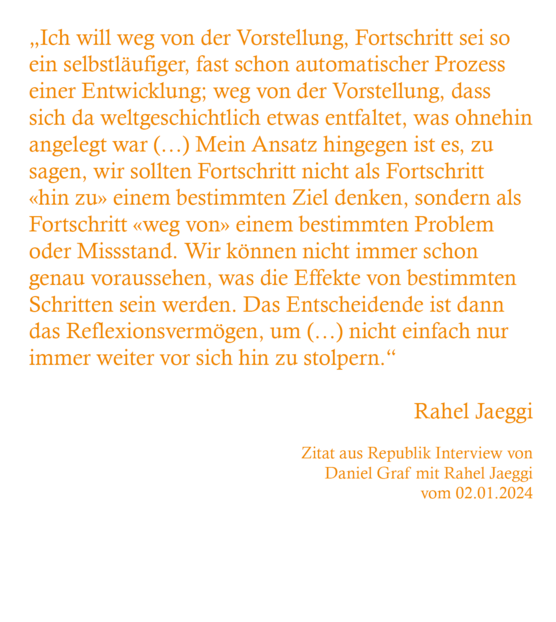
Aus einem Gespräch von Rahel Jaeggi mit der Republik.

Ewa Bouras Taufe, Thessaloniki, 1955 © Privat

Loulou mit Grossmutter Parivash in Spanien, ca. 1992 © Privat

Filomena Lisi 1961 © Privato